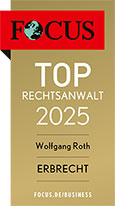Aktuelles aus der Kanzlei
05.02.2026Familienheim versteigern
Teilungsversteigerung durch jeden Miterben zulässig
Ihr Erbrechtsexperte Wolfgang Roth erläutert eine neue Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Jena, wonach jeder Miterbe berechtigt ist, jederzeit die Versteigerung einer Nachlassimmobilie einzuleiten:
Die Hauptentscheidung des OLG
Um die Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft zu erreichen, hat jeder Miterbe - unabhängig von anderen Miterben - das Recht, eine Nachlassimmobilie in die Teilungsversteigerung zu bringen.
Der entschiedene Sachverhalt
Der Verstorbene hinterließ zwei Miterben, die einen Teil des Nachlassles einvernehmlich teilten. Eine Einigung zur Aufteilung der Nachlassimmobilien erfolgte nicht. Ein Miterbe beantragt daraufhin die Teilungsversteigerung über alle Nachlassimmobilien einzuleiten. Dem trat der andere Miterbe entgegen, scheitert damit aber mit seiner Klage vor dem Landgericht (LG) und im Berufungsverfahren vor dem OLG.
Die tragenden Gründe der Entscheidung
Das Thüringer OLG stellt heraus, dass der Anspruch auf Teilungsversteigerung von Nachlassimmobilien nach §§ 2042 Absatz 2, 753 BGB auch vor Auseinandersetzung des Restnachlasses geltend gemacht werden kann. Diese Möglichkeit steht jedem Miterben neben sonstigen zur Herbeiführung der Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft gebotenen Mittel zu. Der bloße Wille eines Miterben, der Versteigerung entgegenzutreten, ist irrelevant. Jeder Miterbe kann die Teilungsversteigerung von Nachlassgrundstücken verlangen, ohne hierbei auf die Zustimmung sonstiger Miterben angewiesen zu sein.
Nur wenn der Verstorbene eine Teilungsanordnung in seinem Testament verfügt hatte oder eine zwischen den Miterben getroffene, gegenteilige Absprache besteht, wäre die Teilungsversteigerung nicht zulässig. Beides ist nicht gegeben.
Praxishinweis für Sie
Es ist gefestigte Rechtsprechung der Obergerichte, dass jeder Miterbe jederzeit das Recht hat, zur Herbeiführung der Gesamtauseinandersetzung der Erbengemeinschaft die Teilungsversteigerung einzuleiten. Nur dann, wenn eine „überraschende Einleitung“ des Versteigerungsverfahrens ohne vorherige Gelegenheit einer gütlichen Einigung unterblieben ist, könnte etwas anderes gelten. Die Versteigerung muss auf die Auflösung der gesamten Erbengemeinschaft durch anschließende Erlösverteilung gerichtet sein. Das wäre nur dann anders, wenn nur ein Teil der Nachlassimmobilien versteigert würde, andere hingegen nicht. Daher sind immer alle Nachlassimmobilien im Wege der Teilungsversteigerung zu versilbern, nicht nur einzelne.
Fundstelle: OLG Jena, Beschluss vom 18.12.2025 – 6 U 468/25
... → mehr12.01.2026
Erbteilung herbeiführen
Was vor der Teilung der Erbschaft nötig ist
Nicht immer kann eine Miterbengemeinschaft sofort auseinandergesetzt werden. Vielfach sind zuerst Maßnahmen oder prozessuale Wege zu beschreiten, bevor es zur Teilung der Erbschaft kommt. Ihr Erbrechtsexperte, Wolfgang Roth, zeigt einen Querschnitt über solch mögliche Maßnahmen auf.
I. Bestellung von Pflegern
- Nicht selten werden in Testamenten Nacherben eingesetzt, die noch gar nicht gezeugt sind, um das Familienvermögen über mehrere Generationen zu steuern. Bis zum Eintritt der Nacherbfolge kann für den noch nicht gezeugten Nacherben eine Nacherbenpflegschaft installiert werden, § 1882 S. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Die Nacherbenpflegschaft ist auf die Anwendung der §§ 2101, 2104, 2105 II, 2106 II BGB zugeschnitten. Dazu bedarf es eines Fürsorgebedürfnisses für gegenwärtige Angelegenheiten, insbesondere, wenn dem (noch nicht gezeugten) Nacherben rechtliches Gehör gewährt werden muss, dessen sonstige Rechte zu wahren sind oder Rechtsgeschäfte durchgeführt werden müssen (§§ 2114, 2116, 2118, 2120-2123, 2127 f., 2142 BGB). Auch wenn ein Antrag auf Löschung eines Nacherbenvermerks im Grundbuch vorhanden ist, bedarf es diese Art der Pflegschaft, wie das Oberlandesgericht Hamm bereits 1997 ausgeurteilt hat.
- Gemäß § 1884 II BGB kann eine Abwesenheitspflegschaft für einen Erben, dessen Aufenthalt bekannt ist, der aber an der Rückkehr und Besorgung seiner Vermögensangelegenheiten verhindert ist, eingerichtet werden. Entscheidend ist, dass der abwesende Erbe gehindert ist, an den Ort, wo die Vermögensangelegenheiten besorgt werden müssen - in der Regel der Sterbeort des Erblassers -, nicht gelangen kann, wobei eine wesentliche Erschwerung hierfür allerdings nicht genügt.
- Nach § 1960 BGB ist eine Nachlasspflegschaft dann anzuordnen, wenn nach Satz 2 der Vorschrift der Erbe unbekannt oder wenn ungewiss ist, ob er die Erbschaft angenommen hat. Hierzu bedarf es der Nachlassfürsorge bzw. von Maßnahmen zur Sicherung der Erbschaft. Nicht genügend ist, wenn zwar die Erben feststehen, deren Erbquoten allerdings strittig sind, wie das OLG München 2025 feststellte. Keine Nachlasspflegschaft wird angeordnet, wenn das Testament eine Testamentsvollstreckung (< s. Video) vorgibt!
- Sollten Vorfragen für die Erbauseinandersetzung gerichtlich durchgesetzt werden, ist nach § 1961 BGB eine Prozesspflegschaft auf Antrag des Anspruchstellers zu installieren. Hierfür bedarf es lediglich der schlüssigen Darlegung eines Anspruchs gegen den Nachlass, z.B., dass ein Vermieter gegen die Erben des verstorbenen Mieters rückständige Miete oder die Nebenkosten einfordern möchte; die Absicht der gerichtlichen Geltendmachung muss für die Bestellung des Pflegers nicht glaubhaft gemacht werden Bei dieser Art der Pflegschaft kann vom Anspruchsteller kein (!) Kostenvorschuss gefordert werden, was auch dann gilt, wenn der Nachlass die Kosten selbst nicht decken würde.
II. Bestellung eines Ergänzungspflegers
Insbesondere dann, wenn minderjährige Miterben vorhanden sind, kommt die Bestellung eines Ergänzungspflegers in Frage, wenn die Eltern ebenfalls erbrechtlich beteiligt sind, §§ 1851, 1629 I S. 2 BGB. Der Katalog des § 1851 BGB führt explizit auf, dass umfangreiche erbrechtliche Maßnahmen der Genehmigung durch das Gericht bedürfen, was insbesondere dann zum Tragen kommt, wenn die Eltern den minderjährigen Miterben im Rahmen ihres Sorgerechts (§ 1629 BGB) vertreten müssen. Die Eltern können also in der Regel nicht die Erbschaft als Sorgeberechtigte für die miterbenden minderjährigen Kinder verteilen, ohne dass das Gericht für die Minderjährigen einen Ergänzungspfleger einsetzt; dieser schützt dann die Interessen der Kinder bei der Erbauseinandersetzung.
III. Ersetzung der Ehegattenzustimmung, § 1365 II BGB
Nicht selten verstirbt ein Ehegatte noch während des Getrenntlebens, also bevor die Scheidung bei Gericht eingereicht wurde. Dann erbt der getrenntlebende Ehegatte mit, wenn kein Testament vorhanden ist, welches diesen Erbanfall ausschließt. Weigert sich dann der miterbende Ehegatte, die Erbauseinandersetzung einvernehmlich durchzuführen, muss dies gerichtlich erzwungen werden. Sofern der Nachlass das gesamte Vermögen des erbenden Ehepartners darstellt, bedarf es nach § 1365 I BGB der Zustimmung dieses Ehegatten. Weigert sich dieser die Genehmigung bzw. Einwilligung zu erteilen, muss die Zustimmung nach § 1365 II BGB ersetzt werden. Hierzu kann ein Antrag auf Ersetzung der Zustimmung des Ehegatten nach § 1365 II BGB gestellt werden.
IV. Feststellungsklage zu einzelnen Nachlasspositionen
Im Rahmen von Erbauseinandersetzungen sind oft nur einzelne Punkte streitig. Um Rechtsicherheit herbeizuführen, auf welche Art und Weise diese bei der Schlussauseinandersetzung berücksichtigt werden können und müssen, kann jeder erbrechtlich Beteiligte eine Feststellungsklage erheben. Damit wird nur dieser Streitpunkt gerichtlich geklärt, so dass er dann in die ansonsten unstreitige Erbteilung einbezogen werden kann.
V. Teilungsversteigerung von Immobilien
Sind Immobilien im Nachlass, handelt es sich dabei um in Natur "unteilbare" Nachlassgegenstände: Ein Haus kann nicht dadurch "aufgeteilt" werden unter den Miterben, indem ein Erbe Z.B. den ersten Stock erhält, ein anderen den Keller usw. Teilbar in Natur sind in der Regel nur Geld oder Wertpapiere. Also muss diese Teilbarkeit (sog. Teilungsreife) bei Uneinigkeit der Miterben erst hergestellt werden.
Zur Herbeiführung der Teilungsreife sind Immobilien bei Streitigkeiten im Wege der Teilungsversteigerung zunächst zu versilbern. Den Antrag auf Teilungsversteigerung kann jeder Miterbe zu jeder Zeit, ohne (!) Zustimmung der übrigen Miterben und unabhängig von seiner Erbquote stellen. Dann steht der Versteigerungserlös der Erbengemeinschaft weiterhin zur gesamten Hand zu und kann dann geteilt werden. Nicht (mehr) zulässig ist die „Nadelstichtaktik“, wonach nur einzelne Nachlassimmobilien anstatt aller Immobilien versteigert werden können: also müssen alle Nachlassimmobilien versteigert werden und nicht nur ein Teil davon.
VI. Klage auf Zustimmung vom Teilungsplan
Sind alle Vorbereitungsmaßnahmen zur Erbteilung durchgeführt und weigert sich einer oder mehrere Miterben, kann eine Klage auf Zustimmung zu einem Teilungsplan erhoben werden. Dies setzt voraus, dass der Nachlass teilungsreif ist, weshalb unteilbare Gegenstände (z.B. Immobilien, Sachen) zuvor durch Teilungsversteigerung versilbert werden müssen (s.o.). Eine solche Erbauseinandersetzungsklage richtet sich gegen den die Erbteilung verweigernden Miterben. Der Teilungsplan orientiert sich zuerst an den Erblasseranordnungen, die im Testament stehen.
Dem Gericht ist allerdings jeglicher gestaltende Eingriff in den eigeklagten Teilungsplan untersagt. Eine Änderung des Teilungsplanes durch das gerichtliche Urteil ist daher nicht möglich. Deshalb führen schon geringste Ungereimtheiten des Teilungsplanes zur Gesamtabweisung der Klage. Daher sind Hilfsanträge zu stellen für den Fall, dass der beantragte Teilungsplan nicht die Zustimmung des Gerichts findet.
VII. Fazit
Die Einleitung der Erbteilung erfordert zunächst einen umfangreichen Überblick auch über sog. Begleit- und Vorbereitungsmaßnahmen. Ihr Fachanwalt für Erbrecht Wolfgang Roth unterstützt Sie, um den Überblick nicht zu verlieren und die Weichen richtig zu stellen. Auch in Ihrer Nähe finden Sie kompetente Ansprechpartner unter www.ndeex.de.
... → mehr11.01.2026
Anlagen zum Testament
Gültigkeit handschriftlicher Anlagen zum Testament
Ihr Erbrechtsexperte Wolfgang Roth bespricht eine neue Entscheidung des Landgerichts (LG) Frankenthal zur Frage, ob eine handschriftlich verfasste Anlage zu einem Testament auch ohne Unterschrift gültig ist:
Der Leitgedanke des Gerichts
Nimmt der Erblasser in einem von ihm handschriftlich verfassten und unterschriebenen Testament auf durch darin mit Nummerierungen versehene Anlagen Bezug, die ebenfalls handschriftlich verfasst, jedoch nicht von ihm unterschrieben sind, gelten die Anlagen als Bestandteil des Testaments und sind trotz fehlender Unterschrift formgültig.
Der entschiedene Sachverhalt
Der Erblasser setzte in verschiedenen, von ihm selbst handschriftlich verfassten und unterschriebenen Testamenten seinen Neffen zum Alleinerben ein. Im Testament bezog er sich auf Anlagen, die er durchnummerierte und in denen einzelne Nachlassgegenstände durch Vermächtnis verteilte. Auch sein Anwalt, den er zugleich mit der Testamentsvollstreckung (< s. Video) beauftragte, erhielt ein Geldvermächtnis. Der Neffe beantragte bei Gericht festzustellen, dass diese Vermächtnisanordnung nicht wirksam ist. Das LG weist seine Klage ab.
Die tragenden Gründe des Urteils
Das in „Anlage 3“ genannte Vermächtnis entspricht dem Erblasserwillen, das in das Testament einbezogen und von der eigenhändigen Unterschrift unter dem Testamentstext gedeckt ist. Ein Verstoß gegen die Formvorschrift des § 2247 BGB liegt nicht vor. Die Anlage stellt inhaltlich eine einheitliche, miteinander verbundene Willenserklärung des Erblassers mit dem Testament dar. Im Rahmen der Auslegung des Testaments kommt das LG zu dem Ergebnis, dass das Geldvermächtnis dem Erblasserwillen entspricht und dieses in der Zusammenschau mit den eröffneten letztwilligen Verfügungen Teil der Gesamtverfügung ist. Die gegenteilige Auffassung des Bundesgerichtshofs (BGH, NJW 2022, 474) ist nicht auf dieses Verfahren übertragbar, da es dort um maschinenschriftliche Anlagen zu einem Testament ging. Demnach genügt es, dass der Erblasser nicht jede einzelne, handschriftlich geschriebene Anlage, sondern nur das „Haupttestament“ unterschrieben hatte.
Praxishinweis für Sie
Das LG stellt richtigerweise heraus, dass Anlagen, die handschriftlich verfasst, jedoch nicht unterschrieben sind, dann Bestandteil des ursprünglichen Testaments sein können, wenn eine Gesamtschau ergibt, dass nach dem Erblasserwillen diese von der dortigen Unterschrift gedeckt sein sollen. Maschinengeschriebene Anlagen erfüllen hingegen die Formvorschrift in aller Regel nicht und sind unwirksam. Um Abgrenzungs- und Auslegungsprobleme zu vermeiden ist zu empfehlen, dass jede Anlage zu einem Testament selbst noch handschriftlich verfasst und jeweils unterschrieben wird, worauf Fachanwalt für Erbrecht Wolfgang Roth hinweist.
Fundstelle: LG Frankenthal, Urteil v. 21.10.2025 – 8 O 116/25
... → mehr06.11.2025
gemeinsamer Tod und gleichzeitiger Tod
Berliner Testament und "gemeinsamer Tod"
Erbrechtsexperte Wolfgang Roth erläutert eine neue Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Brandenburg, das sich um den Begriff „Gemeinsamer Tod“ in einem Berliner Testament abspielt:
Der Leitgedanke des Senats
Setzen Ehegatten in einem Berliner Testament ihre Kinder für den Fall „eines gemeinsamen Todes“ zu ihren Erben ein, spricht dies für eine Schlusserbeinsetzung der Kinder, die nach dem Tod des erstversterbenden Ehegatten nicht mehr geändert werden kann.
Der entschiedene Sachverhalt
Der Verstorbene hatte mit seiner vorverstorbenen ersten Ehefrau zwei gemeinsame Kinder, die Ehefrau brachte zwei weitere Kinder in die Ehe mit. Davon verstarb eines vor beiden Ehepartnern. Die Eheleute errichteten zuvor ein gemeinschaftliches Testament, in welchem sie sich gegenseitig zum Erben einsetzten und bestimmten, dass im Fall „eines gemeinsamen Todes unsere vier Kinder zu gleichen Teilen erben sollen“.
Nach dem Tod seiner Ehefrau heiratete der Erblasser erneut. Mit seiner zweiten Ehefrau errichtete er ein notarielles Testament, in welchem sich beide Ehegatten zu Alleinerben einsetzten. Nach dem Tod des Ehemannes beantragte die Witwe einen Alleinerbschein. Dem widersprachen die drei Kinder des Erblassers und beantragten ihrerseits einen gemeinschaftlichen Erbschein, der sie zu je 1/3 als Erben ausweisen sollte. Das OLG gibt ihnen Recht.
Die tragenden Gründe der Entscheidung
Das OLG sieht in der Einsetzung der (ursprünglich) vier Kinder für den Fall des gemeinsamen Todes eine bindend gewordene Schlusserbeinsetzung nach dem Tod der ersten Ehefrau. Die Auslegung des Willens der Testierenden ergibt, dass sich der Begriff „gemeinsamer Tod“ nicht an einer gleichzeitigen Todesursache orientiert. Die Formulierung deutet vielmehr an, dass die Schlusserbenregelung von den Ehegatten auch für den Fall getroffen wurde, dass sie in zeitlich größerem Abstand voneinander versterben. Bereits die gewählte Formulierung selbst (gemeinsamer Tod) ist gerade nicht auf ein gleichzeitiges Versterben, sondern auf einen gemeinsamen, auch zeitlich nachfolgenden Tod gerichtet.
Der Begriff „gleichzeitig“ setzt hingegen einen eindeutigen zeitlichen Bezug voraus, zu welchem die beiden Todeszeitpunkte eintreten. Dieser ist jedoch gerade nicht von den Testatoren verwendet worden. Der Begriff des „gemeinsamen“ Todes ist daher nicht auf einen engen zeitlichen Zusammenhang beider Sterbefälle beschränkt, sondern deutet auf einen gemeinsamen Zustand, nämlich den Tod beider Eheleute beschreibt. Als Rechtsfolge tritt die gemeinschaftliche Schlusserbeinsetzung der Kinder ein.
Außerdem haben die Kinder aus erster Ehe bestätigt, dass beide Erblasser ihnen gegenüber erwähnten, dass die Kinder im Rahmen eines „Berliner Testaments“ später (also nach dem Tod des letzten Ehepartners) das Erbe antreten würden. Auch dass der Erblasser beim Notar bei Errichtung seines notariellen Testaments mit der zweiten Ehefrau ausdrücklich nachfragte, ob er überhaupt noch testieren dürfe, ist ein Indiz dafür, dass er selbst davon ausging, bereits eine Schlusserbfolgeregelung getroffen zu haben. Wegen der Bindungswirkung hinsichtlich der Schlusserbeinsetzung ist die im notariellen Testament getroffene weitere Schlusserbeinsetzung der überlebenden Ehefrau unwirksam.
Praxishinweis für Sie
Der Senat grenzt in Übereinstimmung mit anderen Oberlandesgerichten die in Berliner Testamenten oftmals verwendeten Begriffe des „gleichzeitigen“ Todes und des „gemeinsamen“ Todes voneinander ab. Ein gemeinsames Versterben kann, muss jedoch nicht ein gleichzeitiges sein. Das OLG stellt auch heraus, dass schon der Sprachgebrauch des „Berliner Testaments“ dafürspricht, dass dort bindende Schlusserbeinsetzungen getroffen sind.
Um sich von einer solchen Bindung zu lösen, bleibt dem überlebenden Ehegatten für den Fall seiner Wiederheirat somit nur das Recht zur Anfechtung des ehemaligen Testaments nach § 2079 S. 1 BGB innerhalb der Anfechtungsfrist von einem Jahr (§ 2082 I BGB).
Fundstelle: OLG Brandenburg, Beschluss v. 11.9.2025 – 3 W 57/25
... → mehr04.11.2025
Einkommensteuer und Bestattungsvertrag
Kein Abzug der Kosten für Bestattungsvorsorge bei Einkommensteuer
Erbrechtsexperte Wolfgang Roth schildert einen aktuellen Fall, wonach das Finanzgericht (FG) die Absetzbarkeit von Aufwendungen für die eigene Bestattungsvorsorge bei der Einkommensteuer abgelehnt hat:
Der Leitgedanke des Finanzgerichts
Aufwendungen für eine Bestattungsvorsorge sind keine außergewöhnlichen Belastungen, weshalb sie nach § 33 I Einkommensteuergesetz (EStG) nicht abzugsfähig sind.
Der entschiedene Sachverhalt
Ein Steuerpflichtiger schloss einen Bestattungsvorsorgevertrag ab, um die späteren Bestattungskosten zu minimieren. Seine Einzahlungen in den Vertrag wollte er als außergewöhnliche Belastungen bei der Einkommensteuer absetzen. Damit scheitert er vor dem FG.
Die tragenden Gründe der Entscheidung
§ 33 I EStG setzt für den Abzug außergewöhnlicher Belastungen voraus, dass einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der Mehrzahl der anderen Steuerpflichtigen gleicher Einkommens- und Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstandes entstehen. Die Rücklagen bzw. Einzahlungen für die Bestattungsvorsorge führen nicht zwangsläufig zu höheren Aufwendungen im Verhältnis gegenüber anderen Steuerpflichtigen. § 33 EStG will Mehraufwendungen für den Grundbedarf berücksichtigen, die sich wegen der Außergewöhnlichkeit einer pauschalen Bezifferung entziehen. Aufwendungen der üblichen Lebensführung sind vom Anwendungsbereich des § 33 EStG nicht umfasst.
Investitionen in die Bestattungsvorsorge sind keine Mehraufwendungen für den existenznotwendigen Grundbedarf, die so außergewöhnlich wären, dass sie sich einer pauschalen Zusammenfassung in allgemeinen Freibeträgen entziehen. Die Notwendigkeit der Bestattung trifft nämlich jeden Steuerpflichtigen.
Auch das Tatbestandsmerkmal der „Zwangsläufigkeit“ ist nicht gegeben. Aufwendungen nach § 33 II 1 EStG sind zwangläufig, wenn der Steuerpflichtige sich ihnen aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann und, soweit die Aufwendungen notwendig sind, einen angemessenen Betrag nicht übersteigen. Die Einzahlungen in eine Bestattungsvorsorge stellen freiwillige Aufwendungen dar, für die weder eine rechtliche, tatsächliche noch sittliche Pflicht gegeben ist.
Praxishinweis für Sie
Das Finanzgericht stellt dar, dass Einzahlungen in Bestattungsvorsorgeverträge einkommensteuermäßig nicht zu berücksichtigen sind. Sie sind freiwillige Leistungen, zu welchen der Einzahler weder rechtlich noch sittlich verpflichtet ist.
Fundstelle: Finanzgericht Münster, Urteil vom 23.6.2025 - 10 K 1483/24 E
... → mehr15.10.2025
Fragen zum Ehegattentestament
Testamente von Ehegatten nicht immer unproblematisch!
Ihr Erbrechtsexperte Wolfgang Roth erläutert an Hand einer Übersicht Praxisfragen zur Gemeinschaftlichkeit von Ehegattentestamenten
Üblicherweise ist die Frage, ob ein gemeinschaftliches Testament vorliegt, nicht problematisch. Allerdings gibt es Konstellationen, die durchaus die Frage aufwerfen können, ob und auf welche Weise die Gemeinschaftlichkeit sowohl nach der äußeren Form des Testaments als auch nach dem subjektiven Erblasserwillen fraglich sein können.
I. Die gemeinsame Testamentserrichtung
§ 2265 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) spricht von einem "gemeinschaftlichen" Testament, das Ehegatten errichten können. Es wird also eine Gemeinschaftlichkeit der Errichtung der letztwilligen Verfügung vorausgesetzt. Dieser Zusammenhang besteht jedenfalls dann, wenn die Ehegatten in einem einzigen Schriftstück gemeinsam testierten und es gemeinsam unterzeichnen. Die Gemeinschaftlichkeit des errichteten letzten Willens muss sich nach außen dokumentieren. In einer einheitlichen Urkunde ist dies objektiv gegeben.
Allerdings muss auch ein subjektiver gemeinschaftlicher Errichtungswille hinzukommen. Jeder der Ehegatten muss bei der Testamentserrichtung beabsichtigen, dass er mit dem anderen letztwillig verfügt. Notfalls kann ein solcher gemeinschaftlicher Wille im Wege der Auslegung ermittelt werden, wie das Oberlandesgericht (OLG) München im Jahr 2024 entschieden hat.
II. Einzelurkunden als Gemeinschaftstestament?
Nicht selten testieren Ehegatten in einzelnen, voneinander getrennten Schriftstücken und gehen davon aus, dass es sich um ein gemeinschaftliches Testament handelt. Hierzu genügt jedoch nicht, dass am selben Tag und Ort und im Wesentlichen der gleiche Wortlaut aufgenommen wird, wie das OLG Nürnberg 2010 feststellte. Durch die wörtliche Bezugnahme in den Einzelurkunden, z.B. durch die Verwendung von „wir verfügen“ oder „gemeinsam regeln wir folgendes...“ sowie bei Regelungen über „den beiderseitigen Nachlass“ kann die Auslegung hingegen ein gemeinschaftliches Testament ergeben. Bereits die Überschrift „gemeinsames Testament“ in den einzelnen Urkunden lässt einen solchen Schluss ebenfalls zu. Haben Ehegatten Einzeltestamente errichtet und später ein gemeinsames Nachtragstestament, in welchem sie auf die ursprünglichen Testamente verweisen, ergibt sich aus dem Nachtragstestament die Gemeinschaftlichkeit aller Verfügungen.
III. Aspekte gegen ein gemeinschaftliches Testament
Die reine Mitunterzeichnung eines Einzeltestaments durch den anderen Ehegatten genügt für sich genommen nicht, um einen gemeinschaftlichen Testierwillen abzuleiten, da die Unterschrift durchaus ausdrücken kann, von den Verfügungen des anderen nur Kenntnis genommen zu haben. Werden zwei Einzeltestamente in einem gemeinsamen Briefumschlag verwahrt, stellt diese Aufbewahrungsart ebenfalls keine Gemeinschaftlichkeit der Verfügungen her. Ebenso ist bei der fehlenden Verwendung von Pluralformen oder über die Verfügungen „über mein gesamtes Vermögen“ keine Gemeinschaftlichkeit bei Einzelschriftstücken anzunehmen, wie das OLG Zweibrücken 2002 urteilte. Verfügt ein Ehegatte nur über seinen Nachlass und erklärt der Ehepartner hierzu schriftlich seinen „Beitritt“ und unterzeichnet dies mit, fehlt der Verknüpfungswille ebenfalls.
Ein gleichzeitiger Errichtungsakt ist hingegen nicht notwendig, um die Gemeinschaftlichkeit zu bejahen, weshalb der nachträgliche Beitritt des Ehegatten durch die Wortwahl im Plural „unser Nachlass“, „wir …“, erfolgen und die Testamente dadurch zu einem gemeinsamen Ehegattentestament verknüpfen kann (OLG Hamm: mehr als 40 Jahre später; OLG München: mehr als 6 Jahre Zeitunterscheid).
IV. Folgerungen
Die Gemeinschaftlichkeit von Ehegattentestamenten kann auch bei separaten Erklärungen auf getrennten Schriftstücken mittels Auslegung ermittelt werden, wenn ein subjektiver Verknüpfungswille bei den Testatoren festgestellt werden kann. Fehlt es hieran, fragt sich, ob die Verfügungen als einseitige Testamente aufrechterhalten werden können: dies ist nach § 140 BGB möglich, wenn der Letzte Wille formgerecht erklärt wurde und bei Kenntnis von der Unwirksamkeit der Gemeinschaftlichkeit eine gleichlautende einseitige letztwillige Verfügung ebenfalls getroffen worden wäre.
... → mehr04.09.2025
Versicherung und Erbausschlagung
Trotz Erbausschlagung bleibt Bezugsrecht bei Versicherung
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine für alle Erben, die ihre Erbschaft zum Beispiel wegen Überschuldung des Nachlasses ausschlagen, wichtige Entscheidung getroffen: Es tritt kein Verlust des Bezugsrechts einer Versicherung trotz Erbausschlagung ein!
Ihr Erbrechtsexperte Wolfgang Roth schildert die neue Entscheidung des BGH in der Schnittstelle zwischen Versicherungs- und Erbrecht:
Der Leitgedanke des BGH:
Hat der Erblasser seine „gesetzlichen Erben“ bei einer Unfallversicherung als Bezugsberechtigte eingesetzt, bleibt ihnen die Bezugsberechtigung auch dann erhalten, wenn sie ihre Erbenstellung als gesetzliche Erben wirksam ausgeschlagen haben.
Der entschiedene Sachverhalt:
Der Erblasser hatte eine Unfallversicherung mit einer Todesfallsumme abgeschlossen und als Bezugsberechtigte sine „gesetzlichen Erben“ im Versicherungsvertrag angegeben. Nach seinem Tod schlugen seine beiden Kinder und weitere Verwandte die Erbschaft wirksam aus. Das Amtsgericht ordnet eine Nachlasspflegschaft mit dem Wirkungskreis „Sicherung und Verwaltung des Nachlasses“ an.
Die Versicherung verweigerte die Auszahlung der Leistung an den Nachlasspfleger, weil die Auszahlung voraussetze, dass nachweislich gesetzliche Erben vorhanden sind und das Erbe nicht ausgeschlagen wurde. Der Nachlasspfleger wollte einen weiteren Nachlasspfleger vom Gericht benannt haben, damit er sich von diesem den Auszahlungsanspruch der Bezugsberechtigten gegen den Versicherer abtreten und auf diese Weise zur Erbschaft ziehen konnte. Amts- und Landgericht lehnten den Antrag ab. Der BGH weist die Rechtsbeschwerde zurück, weil die Bezugsberechtigten nicht "unbekannt" sind.
Die tragenden Gründe der Entscheidung
Laut BGH sind bei der Unfallversicherung, die eine Leistung auf Zahlung des Kapitals vorsieht, nach § 185 VVG die §§ 159 und 160 VVG (Versicherungsvertragsgesetz) analog anzuwenden. Der Versicherungsnehmer kann Bezugsberechtigte für die Leistung benennen (§ 159 I VVG). Der Begünstige erwirbt das Zahlungsrecht spätestens mit Eintritt des Versicherungsfalls, § 159 II und III VVG. Benennt der Versicherungsnehmer als Bezugsberechtigten „dessen gesetzliche Erben“, sind nach § 160 II 1 VVG im Zweifel diejenigen gemeint, die im Todeszeitpunkt als Erben berufen sind.
Die Ausschlagung der Erbschaft hat auf die Bezugsberechtigung keinen Einfluss, § 160 II 2 VVG. Die in diesem Paragrafen genannte Bestimmung der „Erben“ als Bezugsberechtigte stellt nur eine Individualisierung des Forderungsberechtigten dar. Das Bezugsrecht ist jedoch nicht davon abhängig, dass die im Todesfall berufenen Erben die Erbschaft auch tatsächlich annehmen. Gesetzliche Erben waren die beiden Kinder des Verstorbenen nach § 1924 I, IV BGB zu gleichen Teilen. Die Ausschlagung ihrer Erbenstellung ist für das Bezugsrecht demnach irrelevant, so dass die Beteiligten bekannt sind. Der Einrichtung einer weiteren Pflegschaft nach bedarf es daher nicht.
Praxishinweis für Sie
Zunächst überrascht die Entscheidung. Der Senat grenzt zwischen dem Bezugsrecht der Versicherung und der Ausschlagung der gesetzlichen Erbenstellung dergestalt ab, dass die Ausschlagung der Erbschaft für das Bezugsrecht gar nicht relevant ist. Die Versicherungsunternehmen werden ihre Auszahlung daher künftig nicht mehr bei Bezugsberechtigten „gesetzlichen Erben“ von einer tatsächlichen Erbenstellung abhängig machen dürfen.
Für ausschlagende Erben bedeutet der Beschluss, dass sie zwar die Erbschaft ausschlagen, aber dennoch aus einer solchen Versicherung Leistungen erhalten können.
Die Ausschlagung der Erbschaft führt also nicht zwingend zum Totalverlust solcher Ansprüche.
Fundstelle: BGH, Beschluss v. 23.7.2025 – XVII ZA 16/25
... → mehr01.08.2025
Fallstricke bei Pflichtteilsklagen
Schnellschuss bei Pflichtteilsklagen wird teuer!
Erbrechtsexperte Wolfgang Roth erläutert, wie bei falschem Vorgehen mit Klagen beim Pflichtteil Geld verloren gehen kann. Das Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken hat dies jüngst wie folgt entschieden:
Der Leitgedanke des Senats
Klagt der Pflichtteilsberechtigte nicht im Wege einer Stufenklage, sondern unmittelbar auf Zahlung seines Pflichtteils gegen die Erben, ist eine von ihm parallel dazu erhobene Wertermittlungsklage unzulässig.
Der entschiedene Sachverhalt
Der Verstorbene hinterließ seinen Sohn und Enkelinnen, die er zu seinen Erben bestimmte. Der pflichtteilsberechtigte Sohn klagte auf Feststellung des Wertes einer Nachlassimmobilie. Isoliert und parallel dazu klagte er schon auf Zahlung eines Teilbetrages seines Pflichtteils, wobei er den Immobilienwert selbst schätzte. Das Landgericht wies die Wertermittlungsklage mangels Rechtsschutzbedürfnisses als unzulässig ab, wogegen der Sohn Berufung einlegte. Am selben Tag verglichen sich die Parteien im Zahlungsprozess und erklärten den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt. Das OLG legt dem Pflichtteilsberechtigten sämtliche Kosten des Rechtsstreits auf.
Die tragenden Gründe des Beschlusses
Durch die übereinstimmende Erledigungserklärung ist nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des aktuellen Sach- und Streitstands darüber zu entscheiden, wie die Kosten des Rechtsstreits zu verteilen sind. Dabei kommt es auf den zu erwartenden Verfahrensausgang im Rahmen einer summarischen Prüfung der Erfolgsaussichten an. Unter diesen Aspekten hätte der Kläger in seinem Berufungsverfahren verloren. Der Wertermittlungsanspruch dient nur dazu, dass sich der Pflichtteilsberechtigte ein Bild vom Wert der Nachlassimmobilie machen und damit auch das Risiko einer späteren Leistungsklage besser abschätzen kann. Der Wertermittlungsanspruch dient also nur zur Vorbereitung des eigentlichen Zahlungsbegehrens, weshalb der Pflichtteilsberechtigte die Auskunfts- und Wertermittlungsansprüche prozessökonomisch durch eine Stufenklage verknüpfen kann.
Die parallel zur Leistungsklage erhobene Wertermittlungsklage ist unzulässig, weil ihr das Rechtsschutzbedürfnis fehlte. Der bewusste Ausschluss eines Stufenklageverfahrens zur Durchsetzung der Zahlungsansprüche erfolgte durch Zahlungsklage. Innerhalb dieser wäre durch Einholung eines Sachverständigengutachtens der Wert der Immobilie zu schätzen gewesen. Der Sinn des Wertermittlungsanspruchs, dass der Anspruchsinhaber den Wert des Nachlasses besser abschätzen kann, kann vor dem Hintergrund einer bereits vorgenommenen Bezifferung des Zahlungsanspruchs nicht mehr erreicht werden. Daran ändert sich auch nichts, dass nur eine Teilzahlungsklage erhoben wird, denn auch zu deren Begründung kommt es auf den konkreten Nachlasswert an. Mehr als eine reine Schätzung des Wertes der Nachlassimmobilie hätte auch im Wertermittlungsverfahren durch Einholung eines Gutachtens nicht erfolgen können, was ebenfalls für die exakte Bezifferung des Anspruchs im Leistungsverfahren durch Einholung eines Gutachtens der Fall ist. Da aus keinem Aspekt im Rahmen dieser Verfahrenskonstellationen ein Rechtsschutzbedürfnis für die Wertermittlungsklage besteht, trägt der Pflichtteilsberechtigte die Kosten des Rechtsstreits.
Praxishinweis für Sie
Der Pflichtteilsberechtigte war augenscheinlich schlecht beraten: Wenn der Gesetzgeber ein sogenannte Stufenklage zur Verfügung stellt, in der alle Ansprüche in einer Klage verbunden werden können, ist es fehlerhaft, die Ansprüche getrennt und einzeln einzuklagen. Ihr Fachanwalt für Erbrecht Wolfgang Roth kann Ihnen die genauen Verfahrensabläufe eines Pflichtteilsverfahrens erläutern - auch, wie bereits vor Inanspruchnahme eines Gerichts solche Verfahren prozesstaktisch vorbereitet werden müssen.
Fundstelle: OLG Zweibrücken, Beschluss vom 25.06.2025 – 8 U 18/25
... → mehr
14.07.2025
Unterschrift beimTestament
Gezeichnete Wolke ist keine Unterschrift!
Ein Testament ist unwirksam, wenn es der Verfasser mit einer wolkenartigen Zeichnung statt seiner Unterschrift versieht, wie Erbrechtsexperte Wolfgang Roth an Hand eines neuen Urteils des Oberlandesgerichts (OLG) München schildert:
Der Leitgedanke des Senats
Malt der Erblasser ein wolkenartiges Gebilde unter ein mit seiner Ehefrau gemeinschaftlich verfasstes Testament, liegt keine wirksame Unterschrift vor, weshalb das Testament formunwirksam ist.
Der entschiedene Sachverhalt
Der Verstorbene hatte unter anderem aus erster Ehe Kinder. Mit seiner zweiten Ehefrau errichtete er ein gemeinsames handschriftliches Testament. Die zweite Ehefrau schrieb den Testamentstext selbst, unterschrieb und der Erblasser setzte ein wolkenartiges Gebilde statt seiner Unterschrift unter deren Unterschrift. Nach seinem Tod beantragte die Witwe einen Alleinerbschein auf Grund des Testaments. Das Nachlassgericht weist den Antrag ebenso zurück wie die Beschwerdeinstanz.
Die tragenden Gründe der Entscheidung
Dem Ehegattentestament fehlt die wirksame Unterschrift des Erblassers, weshalb gesetzliche Erbfolge eintritt. Die wolkenartige Darstellung stellt keine Unterschrift nach § 2247 I BGB dar, weshalb es unheilbar nichtig ist.
Eine Unterschrift setzt ein Gebilde voraus, das aus Buchstaben einer üblichen Schrift besteht. Dies muss nicht unbedingt lesbar sein, sofern es sich um einen die Identität des Unterzeichners ausreichend kennzeichnenden individuellen Schriftzug handelt, der charakteristische Merkmale aufweist und sich nach dem Schriftbild als Unterschrift eines Namens darstellt. Es kommt nicht darauf an, dass die Unterschrift insgesamt lesbar sein muss, denn es genügt, wenn dem Schriftbild zumindest noch Andeutungen von Buchstaben entnommen werden können. Deshalb reicht die Unterzeichnung mit einer reinen Wellenlinie ebenso wenig für das Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift wie die Unterzeichnung mit drei Kreuzen.
Der wolkenähnlich geformten Linie des Erblassers fehlt bereits das Element des Schreibens; Schrift setzt eine zumindest angedeutete Ausformung von Buchstaben, welche eine individuelle Personenbezeichnung nach außen oder im Innenverhältnis zum Adressaten darstellen können, voraus. Eine Zeichnung ist gerade keine Schrift und deswegen auch keine Unterschrift.
Praxishinweis für Sie
Die Entscheidung zeigt einmal mehr, an welchen Formerfordernissen ein letzter Wille scheitern kann: An der Unterschrift des Verfassers, die seine Eigenhändigkeit und das Bekenntnis zu dem über der Unterschrift befindlichen Text bestätigt, darf es keine Zweifel geben. Sehen Sie deshalb von - auch gut gemeinten oder optisch schönen - Zeichnungen, Abkürzungen des Namens oder sonstigen Aspekten ab, die nichts mit ihrem Namen zu tun haben, wenn Sie ein Testament verfassen und unterschreiben. Das Gesetz verlangt hierfür ganz einfach Ihre Unterschrift!
Fundstelle: OLG München, Beschluss v. 5.5.2025 – 33 Wx 289-24 e
... → mehr26.06.2025
Erbschaftsteuer Finanzamt
Die zuständigen Finanzämter für Erbschaftsteuer in Baden-Württemberg
Die 8 Erbschaftsteuerfinanzämter für Baden-Württemberg
Nicht jedes der 63 allgemeinen Finanzämter in Baden-Württemberg hat eine Erbschaft- und Schenkungsteuerstelle. Diese sind auf die 8 Finanzämter in Aalen, Freiburg-Land, Karlsruhe-Durlach, Mosbach, Reutlingen, Sigmaringen, Tauberbischofsheim und Villingen-Schwenningen konzentriert.
Hier finden Sie die Anschriften und Zuständigkeitsbezirke:
Finanzamt Aalen (Bleichgartenstraße 17, 73431 Aalen) ist als Erbschaftsteuerstelle zuständig für die Finanzamtsbezirke
- Aalen
- Heidenheim
- Schorndorf
- Schwäbisch-Gmünd
- Schwäbisch-Hall
- Ulm
- Waiblingen
Finanzamt Freiburg-Land (Stefan-Meier-Straße 133, 79104 Freiburg) ist als Erbschaftsteuerstelle zuständig für die Finanzamtsbezirke
- Emmendingen
- Freiburg-Land
- Lahr
- Lörrach
- Mühlheim
- Offenburg
Finanzamt Karlsruhe-Durlach (Prinzessenstraße 2, 76227 Karlsruhe) ist als Erbschaftsteuerstelle zuständig für die Finanzamtsbezirke
- Baden-Baden
- Bruchsal Calw
- Ettlingen
- Freudenstadt
- Karlsruhe-Durlach
- Karlsruhe-Stadt
- Mühlacker
- Pforzheim
- Rastatt
Finanzamt Mosbach (Außenstelle/Erbschaftsteuerstelle: Albert-Schneider-Straße 1, 74731 Walldürn) ist als Erbschaftsteuerstelle zuständig für die Finanzamtsbezirke
- Heidelberg
- Mannheim-Neckarstadt
- Mannheim-Stadt
- Mosbach
- Schwetzingen
- Sinsheim
- Weinheim
Finanzamt Reutlingen (Leonhardsplatz 1, 72764 Reutlingen) ist als Erbschaftsteuerstelle zuständig für die Finanzamtsbezirke
- Bad Urach
- Böblingen
- Esslingen
- Göppingen
- Leonberg
- Nürtingen
- Reutlingen
- Tübingen
Finanzamt Sigmaringen (Karlstraße 31, 72488 Sigmaringen) ist als Erbschaftsteuerstelle zuständig für die Finanzamtsbezirke
- Balingen
- Biberach
- Ehingen
- Friedrichshafen
- Ravensburg
- Sigmaringen
- Überlingen
- Wangen
Finanzamt Tauberbischofsheim (Außenstelle Bad Mergentheim, Schloss 7, 7980 Bad Mergentheim) ist als Erbschaftsteuerstelle zuständig für die Finanzamtsbezirke
- Backnang
- Bietigheim-Bissingen
- Heilbronn
- Ludwigsburg
- Öhringen
- Stuttgart I
- Stuttgart II
- Stuttgart III
- Stuttgart-Körperschaften
- Tauberbischofsheim
Villingen-Schwenningen (Weiherstraße 7, 78050 Villingen-Schwenningen) ist als Erbschaftsteuerstelle zuständig für die Finanzamtsbezirke
- Konstanz
- Rottweil
- Singen
- Tuttlingen
- Villingen-Schwenningen
- Waldshut-Tiengen
... → mehr